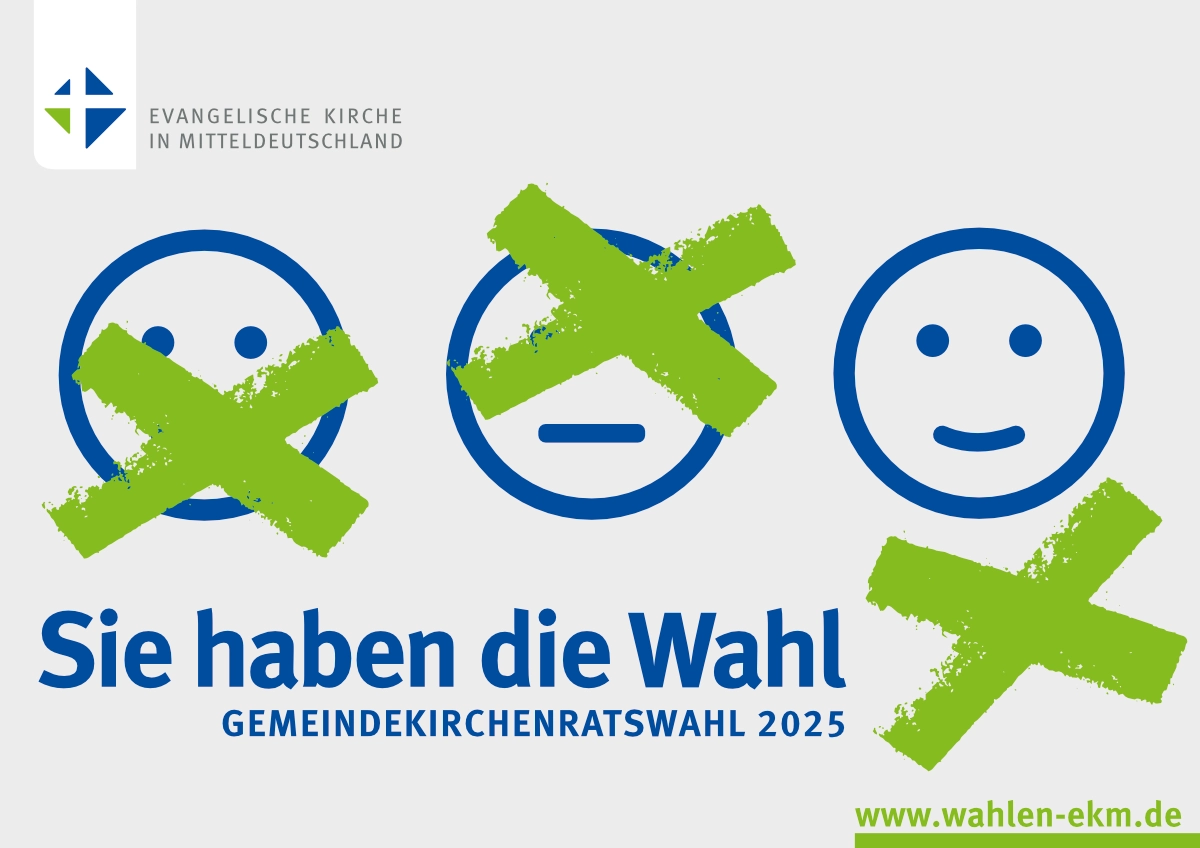21.09.2025
Predigt von Heinrich Bedford-Strohm
21. September 2025 in Mühlhausen - Abschluss der Predigtreihe im Müntzer-Gedenkjahr
Predigt über 2. Tim 1,7 am 21. September 2025 in Mühlhausen
2. Tim 1,7: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Liebe Gemeinde hier in Mühlhausen,
der Satz aus dem 2. Timotheusbrief, der, völlig unabhängig von mir, für den heutigen Sonntag in dieser Predigtreihe ausgesucht worden ist, begleitet mich seit rund 5 Jahren ganz persönlich in besonderer Weise. Er ist für mich zu einem biblischen Leitwort geworden. Wenn ich mich, jetzt in meiner Funktion als Vorsitzender des Weltkirchenrats, irgendwo in ein Goldenes Buch eintrage, dann steht in der Regel dieser Satz im Zentrum meines Eintrags.
Er ist mir so wichtig geworden, weil er mir, und nicht nur mir, in einer Situation der Bedrängnis zur besonderen Kraftquelle geworden ist. Es waren die ersten Monate der Pandemie, als man noch viel zu wenig wusste über Gefahren des Corona- Virus und die Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen, als es noch keine Schutzkleidung gab, als der Lockdown die Menschen zunehmend in der Seele belastete, als wir im Fernsehen die Bilder von den Leichensäcken auf den Armeewägen in Bergamo und in den Kühllastern in New York sahen, als in den abendlichen Sondersendungen die ganze Zeit über virologische Inzidenz gesprochen wurde, die seelische Inzidenz aber kaum Thema war.
Da war dieser Satz eine große Quelle der Kraft und der Orientierung. Ich habe ihn als Überschrift über meine Kanzelabkündigung als Landesbischof gewählt, die am 15. März vor 5 Jahren auf allen bayerischen Kanzeln verlesen wurde. In einer Zeit, in der die Angst sich auszubreiten drohte, brauchten wir Kraft. In einer Zeit, in der wir uns immer öfter schnell über andere zu empören drohten, brauchten wir Liebe. In einer Zeit, in der die Nervosität stieg, brauchten wir Besonnenheit.
Die Pandemie ist inzwischen überwunden. Die seelischen – und für manche auch körperlichen - Folgen noch nicht. Und die Weltlage hat sich so entwickelt, dass wir auch jenseits der Pandemie Kraftsätze wie diese Worte aus dem 2. Tmotheusbfrief dringend brauchen: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Der Satz spricht nicht nur in eine schwere Situation, er kommt auch aus einer schweren Situation. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Es ist ein dunkler Ort, von dem aus er seinem jungen Begleiter Timotheus einen Brief schreibt. Man kann sich vorstellen, wie es ist, in einem dunklen Keller zu sitzen, nicht zu wissen, ob man diesem lebensfeindlichen Ort noch einmal entkommt. Nicht zu wissen, was die Zukunft bringt. Nicht zu wissen, ob ich meine lieben Freunde und Verwandten noch einmal sehe.
Was Paulus da erfährt, ist ja auch vielen von uns nicht fremd, auch wenn es kein Gefängnis ist, in dem wir sitzen. Solche Zeiten der Bedrohung, die kennen wir auch. Persönlich und als Gemeinschaft. Sei es, dass jemand schwer krank ist und sowohl der Kranke wie auch die Familie leiden. Sei es, dass jemand Schwierigkeiten in der Arbeit hat und seine finanzielle Existenz bedroht ist. Sei es, dass es Streit und Entzweiung in Familien, Freundschaften und Beziehungen gibt.
Und die Weltlage droht uns auch heute gerade immer wieder so herunterzuziehen, dass manche gar keine Nachrichten mehr schauen oder hören wollen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Ob es der Krieg in Gaza und in der Ukraine ist oder die unsichere Wirtschaftslage oder die beunruhigenden Prognosen im Blick auf die Erderwärmung und ihre katastrophalen Folgen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen hier in Mühlhausen vor 500 Jahren ganz ähnliche Gefühle empfunden haben, so groß der Abstand in Zeit und Kultur zu heute auch sein mag. Es war eine Zeit des Umbruchs, in der Thoms Müntzer hier in Mühlhausen Pfarrer war. Ob auch er in seiner Zeit hier in Mühlhausen über das Wort aus dem 2. Timotheus gepredigt hat, weiß ich nicht. Und ich maße mir auch nicht an, zu darüber zu spekulieren, was er gesagt hätte. Aber dass das Bibelwort auch damals Kraft und Orientierung gegeben hat, daran habe ich keinen Zweifel.
Der Frühkapitalismus begann das Leben der Menschen immer mehr zu verändern. Für die meisten, allen voran die Bauern, war der Umbruch vom Feudalsystem zum sich entwickelnden Kapitalismus keine Befreiung. Sie gerieten von einer Abhängigkeit in die andere. Nicht nur Thomas Müntzer, sondern auch sein großer Gegenspieler Martin Luther waren sich darüber einig: Die neue Wirtschaftsform schert sich nicht um das Schicksal der Armen, sondern liefert sie schutzlos der Willkür der Mächtigen aus.
„Könige und Fürsten sollten hier drein sehen“ – sagt Martin Luther in seiner 1524 erschienenen Schrift „Von Kaufshandlung und Wucher“ – „und dem nach strengem Recht wehren. Aber ich höre, sie haben Anteil daran und es geht nach dem Spruch Jes. 1, 23: »Deine Fürsten sind der Diebe Gesellen geworden.« Dieweil lassen sie Diebe hängen, die einen Gulden oder einen halben gestohlen haben, und machen Geschäfte mit denen, die alle Welt berauben und mehr stehlen, als alle anderen, damit ja das Sprichwort wahr bleibe: Große Diebe hängen die kleinen Diebe, und wie der römische Ratsherr Cato sprach: Kleine Diebe liegen im (Schuld)turm und Stock, aber öffentliche Diebe gehen in Gold und Seide.“
Müntzer und Luther waren nicht Gegenspieler im Eintreten für die Armen – wohl aber in der Frage der strategischen Konsequenzen. Während Luther darauf setzte, dass die Fürsten zur Vernunft kommen würden, setzte Müntzer auf den bewaffneten Widerstand der Bauern. Für beide endete es im Desaster. Für Müntzer, indem die Bauern 60 km von hier, in Frankenhausen, vernichtend geschlagen wurden und er selbst grausam hingerichtet wurde. Und für Luther, indem er durch seine ebenso emotionalen wie fürchterlichen Worte über das Dreinschlagen gegen die Bauern seine moralische Glaubwürdigkeit verlor. Beide scheiterten, weil sie nicht auf diesen Satz des Paulus gehört haben: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Am Ende hat nicht nur die Besonnenheit gefehlt, sondern auch die Liebe. Die Liebe, die Müntzer und den Bauern doch die ganze Zeit so nahe war in der Fahne, die sie die ganze Zeit mitführten und die einen Regenbogen zeigte – und dazu die Worte „verbum domini maneat in etternum“, „das Wort des Herrn bleibe in Ewigkeit“. Müntzer hatte die Fahne anfertigen lassen und hinter der Kanzel in der Mühlhäuser Marienkirche versteckt angebracht. Alle, die zum Bündnis gehören wollten, wurden aufgefordert, sich unter diese Fahne zu stellen.
Bis heute ist der Regenbogen, inspiriert durch die biblische Sintflutgeschichte, ein Symbol für Gottes Nähe, Gottes Treue und vor allem: Gottes Liebe. Ja, genau für die Liebe, von der Paulus zusammen mit der Kraft und der Besonnenheit spricht. Der Regenbogen ist für mich das Symbol dafür geworden, dass Gott sich auf die Liebe festgelegt hat. Ich habe die Geschichte von der Sintflut seit der Kindheit oft gehört und habe später auch immer wieder darüber nachgedacht und darüber gepredigt. Erst spät habe ich das entdeckt, was für mich heute das Wichtigste daran ist: Gott bewegt sich. Gott geht mit dem Menschen mit. Gott legt sich auf die Liebe fest.
Warum schickt Gott die Sintflut? Weil die Menschen so anders handeln als Gott es sich in der Schöpfung gedacht hat. Die Geschichte von Kain und Abel ist der deutlichste Ausdruck davon: Die Menschen bringen sich um. Der Versuch Gottes, den Menschen zur Mitmenschlichkeit zu erschaffen, ist gescheitert. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an, heißt es im biblischen Text. Aber Gott bringt es nicht übers Herz. Er lässt Noah die Arche bauen. Der Regen hört irgendwann auf. Und die Menschen dürfen weiterleben. Obwohl Gott ganz genau weiß, dass die Menschen immer wieder die guten Gebote Gottes missachten werden, verspricht er ewige Treue:
„Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. Mose 8,21ff).
Gott ändert sich. Er legt sich auf die Liebe gegenüber den Menschen fest. Und bekräftigt seine ewige Liebe und Treue dadurch, dass er den Regenbogen in die Wolken setzt. Und uns die Kraft zu einem in Liebe, in Vielfalt, in Würde gibt, so wie es draußen auf der Regenbogenfahne steht.
Es ist nicht die moralische Ermahnung, die mit dem Regenbogen verbunden ist, sondern es ist die Zusage, die wir von Gott bekommen, dass wir bedingungslos geliebt und angenommen sind. Wo wir das hören, wo wir es in uns spüren, wo wir es tief in der Seele glauben, da werden wir die Liebe, die Vielfalt, die Würde, die damit verbunden ist, auch den anderen gegenüber ausstrahlen. Da werden wir dem Hass die Liebe entgegensetzen. Da werden wir an die Stelle des Starrens auf die erwartete Apokalypse die Hoffnung setzen. Da werden wir in der Erschöpfung neue Kraft bekommen. Und 500 Jahre nach Thomas Müntzer im Zeichen des Regenbogens die Wahrheit jenes Satzes aus dem 2. Timotheusbrief spüren, eines Satzes, der in einer geängstigten, verunsicherten und gespaltenen Welt aktueller ist denn je: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
AMEN