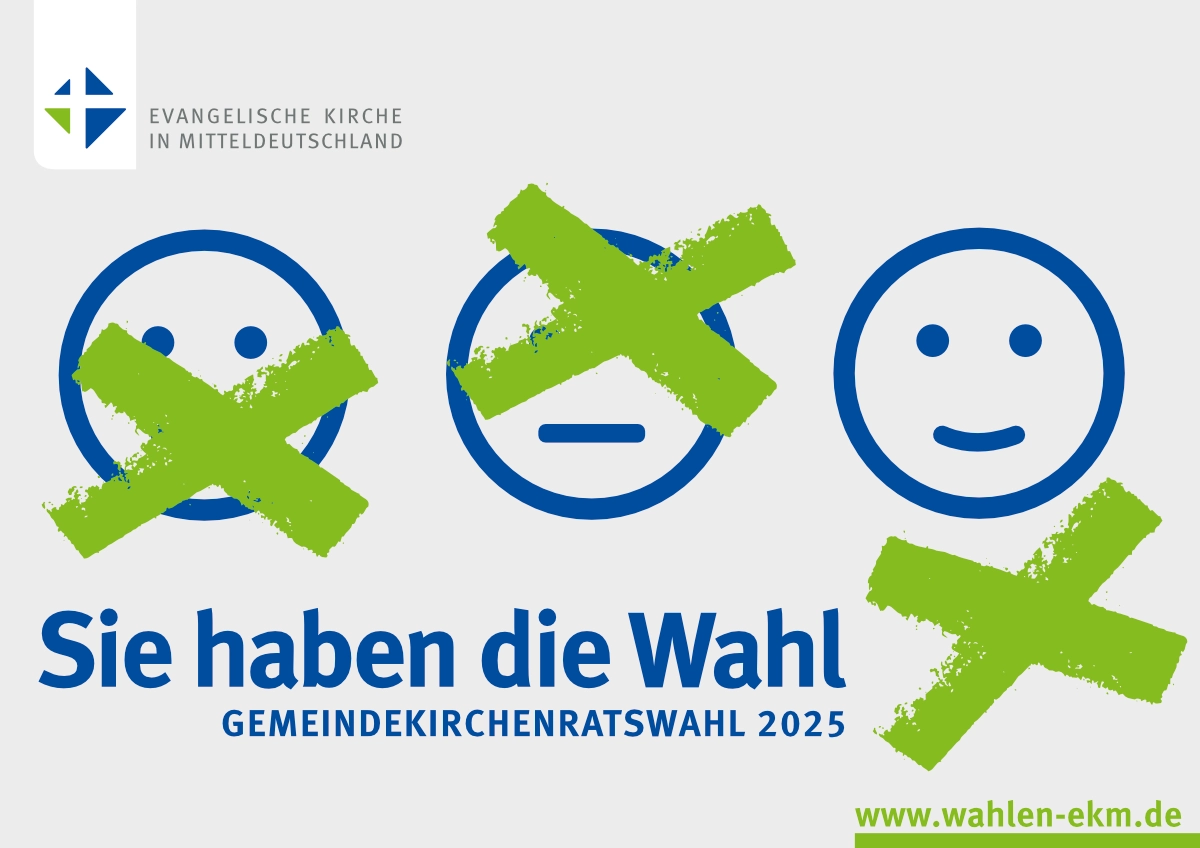Sep 15, 2025
Eindrücke zum Müntzer-Oratorium von Christiane Döbel
Anlässlich der Uraufführung am 14. September 2025 in Mühlhausen
"Das Innere Wort - Ein Müntzer-Oratorium"
In diesem Oratorium in konzertanter Form steht im Mittelpunkt der dramatischen Handlung ein sehr irdisches Thema, das aber zugleich ein zutiefst geistliches ist: das Verhör Thomas Müntzers in der Festung Heldrungen, nach seiner Folterung und vor seiner Hinrichtung 1525 vor den Toren Mühlhausens, auf Befehl Graf Ernsts II. Eine Geschichte wird erzählt.
Welche Musik kann dem gerecht werden, was da vor 500 Jahren geschah ?
Nein, keine süffigen, üblichen Harmonien. Keno Hankel arbeitet mit vielen variablen Mitteln moderner Komposition in Rhythmik, Harmonik, Melodik. Was macht diese Musik hier aus ?
Immer wieder durchbrechen und attackieren dissonante Akkorde die eher traditionelle Tonalität.
Der die Einheit beschwörende Gesang der Bauernhaufen wird empfindlich gestört und aufgeschreckt durch metallischen Trommelwirbel und den programmatischen Missklang der Bläser. Die 12 Artikel des Manifestes werden jeweils durch Trommel, Paukenschlag oder dumpfe Bässe angekündigt und durch den Chor wie bei einer antiken griechischen Tragödie kommentiert und bestätigt.
Im Verbund spielen und singen der Bachchor Mühlhausen und die Thüringen Sinfonietta, deren Orchester in kleiner Besetzung mit alten Instrumenten.
Eine Verschärfung der Tempi, die stakkatoartige Modulation und die zunehmende Lautstärke, das Crescendo, sie führen nicht zur wohltuenden Auflösung, nein, sie enden in einem grellen atonalen Klang, der das Publikum zurücklässt in Aufruhr und ratlosem Unbehagen. Ein Zurücklehnen gibt es nicht.
Andreas Hillger erarbeitete das Libretto des Oratoriums im zeitgemäß starken sprachlichen Ausdruck der Renaissance, wie er auch in den Flugblättern zu finden war, derb und bildhaft. Freie Rede wie bei der Stimme 1 von Simon Köslich/Berlin; Reimungen, Mischung aus gesprochenen und rezitativen Passagen wechseln einander ab. Für das Publikum ist es schön, alle Texte in einer Beilage verfolgen zu können.
Als ein Kernstück des Oratoriums kann wohl die Beschreibung des Regenbogens in Teil IV gelten, den Thomas Müntzer als Zeichen des Bundes durch Gott mit der Schöpfung gesehen haben mag. Diese Beschreibung machen die beiden Frauenstimmen (Sopran, Barbara Steude/Dresden, Stimme 2; und Alt, Anna-Maria Torkel/Buchholz, Stimme 3) in poetischen Worten und in lieblichem Gesang, untermalt durch sphärische Geigenklänge. Ein schmeichelnder Gegensatz zu all der Gewalt, die in den Worten und suggestiven Bildern die Grundstimmung des gesamten Verhörs ausmachen.
In der Interpretation von Stephan Heinemann aus Leipzig, Bass, bleibt Thomas Müntzer das gesamte Verhör hindurch seltsam gefasst und ruhig. Nicht einmal in seiner Verteidigung, in seinem Versuch der Rechfertigung und der Korrektur der falschen Anschuldigungen erhebt er die Stimme. Nicht die Folter hat ihn gebrochen oder die Gewissheit, dieses Verhör nicht zu überleben. Vielmehr bewegt ihn das Wissen um die Vergeblichkeit allen Mühens und Sterbens so vieler seiner Kämpfer.
Die Hinrichtung Müntzers vor den Toren Mühlhausens im Mai 1525 bringt auch seine verba interna, seine inneren Worte in seiner Zwiesprache mit Gott, zum Verstummen.
Einzig die letzte Sequenz des Oratoriums, das „Verleih´uns Frieden gnädiglich“ dieses uralten Chorals, der einst von Martin Luther übersetzt und vertont worden war, hier aber durch den Komponisten Keno Hankel eine andersartige Tonalität erhält, gibt Hoffnung.
Versöhnlich und die Zeiten überdauernd.
Die klare musikalische und textliche Form dieses Oratoriums in einer überzeugenden Verbindung, in der geistiger Anspruch und emotionale Ausdruckskraft die Hörer erreichen und berühren, - das eine. Die Gesamtwirkung durch Chor, Solisten und Orchester, unter der künstlerisch kompetenten und sichtbar höchst engagierten Leitung von Oliver Stechbart , - das andere.
Der brausende Applaus des Publikums zeigt es.
Christiane Döbel